DEINE SPENDE KANN LEBEN RETTEN!
Mit Amnesty kannst du dort helfen, wo es am dringendsten nötig ist.
DEINE SPENDE WIRKT!
"Wollen wir das so in Europa?"
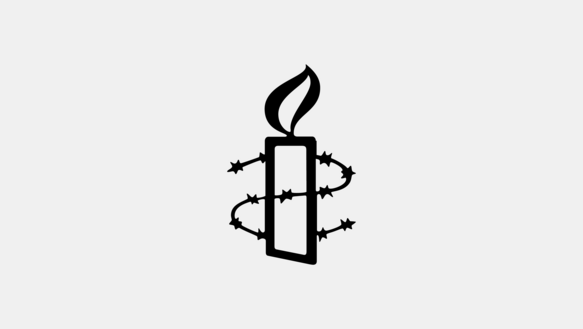
Die ARD-Reporterin Isabel Schayani berichtet seit Jahren über Flucht und Flüchtende. Ein Gespräch über die Berichterstattung zum Thema und die Verantwortung von Journalist*innen.
Interview: Uta von Schrenk
Sie haben für die ARD über Flucht aus der Ukraine berichtet. Welche Erlebnisse sind Ihnen besonders in Erinnerung?
An der ukrainisch-polnischen Grenze habe ich Anfang März 2022 eine Deutschlehrerin aus Kiew getroffen, die mit ihrer kleinen Tochter und ihrer Mutter geradezu ins Nichts geflohen war. Sie war völlig aufgelöst, und die Mutter schämte sich, weil sie von zu Hause losgerannt war und sich nicht richtig hatte anziehen können. Sie schaute aus Scham immer weg und vergrub die Hände in ihrem Wintermantel. Solche Momente wird man als Reporterin nicht los. Wir sind in Kontakt geblieben, und so habe ich erfahren, dass sie mittlerweile Lehrerin in einem Integrationskurs ist, dass das Kind gern zur Grundschule geht und die Oma bei ihnen ist. Für sie hat sich erstmal alles gefügt.
Doch es gibt auch andere Begegnungen: Wir waren an einem Vormittag im Januar diesen Jahres in der schwer umkämpften Stadt Bachmut. Dort haben wir eine ältere Dame getroffen, 74 Jahre alt, elegant gekleidet, obwohl sie weder etwas Richtiges zu essen hatte, noch Wärme oder eine sichere Unterkunft. Sie ist geblieben, weil ihr Mann sterbenskrank war und nicht mehr evakuiert werden konnte. Nachdem die Lage in Bachmut immer schwieriger geworden ist, frage ich mich: Was ist wohl aus Nina Gregoriewna geworden? Da ich keine Handynummer von ihr habe, werde ich es nicht erfahren. Solche Erlebnisse trägt man mit sich.
Was macht das mit Ihnen?
Weil ich kein Russisch oder Ukrainisch spreche, gab es für mich in diesen Situationen durch die Sprachbarriere einen gewissen Filter. Anders war das bei früheren Begegnungen auf der Balkanroute oder in Calais, wo ich im November war. Dort habe ich Afghanen getroffen, die wie ich Persisch sprechen. Solche Gespräche haben für mich eine andere Temperatur, eine andere Unmittelbarkeit. Sprache ist ein wesentlicher Faktor, wie nah man Menschen kommt. Man kann sich dann nicht mehr hinter einem Übersetzer verstecken. Im Nachhinein bin ich fast ein wenig froh, dass ich in der Ukraine nicht alles verstanden habe, weil ich in den Momenten wohl nicht hätte weiterfragen können, bei dem was die Menschen uns antworteten.
Welche Verantwortung kommt den Berichterstattenden bei der Vermittlung schrecklicher Vorgänge zu?
Auf der einen Seite hat das Thema Flucht eine abstrakte Dimension, wenn wir über EU-Außengrenzen, über Asylpolitik oder die aktuellen Geflüchtetenzahlen reden. Auf der anderen Seite steht das konkrete Schicksal von Menschen, die vor einem stehen und nicht wissen, wo sie die nächste Nacht schlafen werden. Als Journalist*innen sind wir gefordert, diese beiden Welten zusammenzubringen, abstrakte Politik in Menschenleben zu übersetzen. Es geht darum, den Schmerz der Betroffenen zu vermitteln, ohne den Blick für die reale Lage zu verlieren. Wenn mir jemand an der Grenze erzählt, dass er schon seit Tagen bei null Grad im Wald campiert hat, dann werde ich still – und dennoch muss ich einen Schritt zurückmachen und überlegen, ob das stimmen kann oder nicht. Da ist es gut, wenn man im Team arbeitet und das Erlebte besprechen kann. Denn das gehört auch zur journalistischen Verantwortung: zu entscheiden, mit welcher Distanz oder Nähe ich eine Geschichte erzähle. Und was ich für glaubwürdig halte und was nicht.
Gibt es Momente, in denen diese Rolle eine Überforderung ist?
Wenn Kinder im Spiel sind. Wir waren im Februar im Donbass an der Front, in einem Bus voller Menschen, die evakuiert werden sollten. Da saßen die Leute mit ihren zwei Plastiktüten, den Kindern und der Katze. Kinder auf der Flucht spiegeln die Unsicherheit ihrer Eltern, sie sind unruhig oder erstarrt. Zugleich können sie aber die Dimension der Lage nicht einschätzen und spielen zwischendurch einfach wieder. Das Lager Moria in Griechenland war wie ein Schulhof, da wuselten die Kinder nur so durcheinander. An der ukrainisch-polnischen Grenze vor einem Jahr habe ich zuerst gedacht: Ist das hier ein Schulausflug? Es waren so viele Kinder. Wenn man selbst Mutter ist, ist es schwer, in solchen Situationen einen gänzlich nüchternen Blick zu bewahren.
Zerstörte Boote auf dem Mittelmeer, Menschen hinter Maschendraht, überfüllte Bahnhöfe – wir alle haben bei dem Stichwort Flucht sofort Bilder im Kopf. Wie vermeidet man die Übersättigung des Publikums?
Die lässt sich kaum vermeiden. Nach dem Syrienkrieg, nach Corona, der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, dem Krieg in der Ukraine, nach den revolutionären Entwicklungen im Iran und dem Erdbeben in der Türkei und Syrien höre ich immer wieder in meinem Umfeld: Ich kann keine Nachrichten mehr sehen. Ich verstehe diese Erschöpfung. Doch leider ist die Realität so. Die Herausforderung für uns alle, für die Journalist*innen wie für das Publikum, besteht darin, trotz dieser Bilderflut nicht zu verrohen. Die zentrale Frage bei dem Thema Flucht ist doch: Wollen wir das so in Europa?
Wie hat sich die mediale Darstellung von Geflüchteten nach Merkels "Wir schaffen das" und der anfänglichen Empathie angesichts des Ukrainekriegs gewandelt?
Meine Wahrnehmung ist, dass Frust und der Wille, das hinzukriegen sich derzeit noch die Waage halten. Es liegt an uns, ob wir zwei Klassen von Geflüchteten wollen. Hier das Asylrecht und da die Massenzustrom-Richtlinie mit einem vorübergehenden Schutzstatus. Ich habe mit vielen deutschen Kommunalbeamt*innen gesprochen, um zu erfahren, wie die Lage vor Ort tatsächlich ist – auch, um die mediale Stimmung zu überprüfen. Die Antworten waren überwiegend konstruktiv, dabei funktionieren viele Ausländerbehörden schon lange nicht mehr richtig: Ja, wir können in eine Krise rutschen, aber wir sind total gewillt, es zu wuppen. Diese Grundstimmung kann man dunkel, aber auch hell malen. Natürlich ist die Situation angespannt, das darf man nicht kleinreden. Auch in Schulen, Kindergärten, Ämtern. 1,2 Millionen Menschen sind im vergangenen Jahr zusätzlich nach Deutschland gekommen. Dies ist kein Zustand, der vom Himmel fällt, sondern die Folge davon, dass wir von der Welt und ihren Krisen nicht entkoppelt sind. Ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft daran wachsen kann, einen Teil dieser Krisenfolgen zu tragen.
Was ärgert Sie an der Thematisierung und Inszenierung von Flucht in den Medien?
Die Extreme in der Berichterstattung: Manche stecken die Menschen, die hier um Asyl bitten, eindimensional in die Opferkiste, andere malen ein krasses Bedrohungsszenario. Beides wird der Situation nicht gerecht. Doch überwiegend finde ich, dass wir Journalist*innen differenzierter mit dem Thema umgehen als noch 2015.
Wo liegen die blinden Flecken der Berichterstattung über Flucht?
Die Situation der Afghan*innen ist aus dem Blickfeld geraten: Wie ist es um das Bundesaufnahmeprogramm des Auswärtigen Amtes bestellt? Wie viele gefährdete Menschen konnten sich hierüber nach Deutschland retten? Oder ist dieses Programm überbürokratisiert? Dann die Visaverteilung und Familienzusammenführung an deutschen Auslandsvertretungen: Diese sind zum Teil chronisch unterbesetzt – und ich habe den Eindruck, sie sollen es vielleicht auch sein. Die Menschen haben es schwer, über diesen legalen Weg zu uns zu kommen. Und was ist aus der Erteilung der humanitären Visa geworden, die die Außenministerin nach dem Beginn der Protestbewegung im Iran versprochen hatte? Mit so einem Versprechen kann man die Öffentlichkeit erstmal beruhigen. Ein blinder Fleck sind auch die menschenverachtenden und ökonomischen Aspekte der Schlepperstrukturen.
Isabel Schayani ist Moderatorin des "Weltspiegel" und Leiterin der Redaktion "WDRforyou". 2022 zeichnete Amnesty sie mit dem Marler Medienpreis für Menschenrechte aus.
Uta von Schrenk ist Redakteurin des Amnesty Journals.









